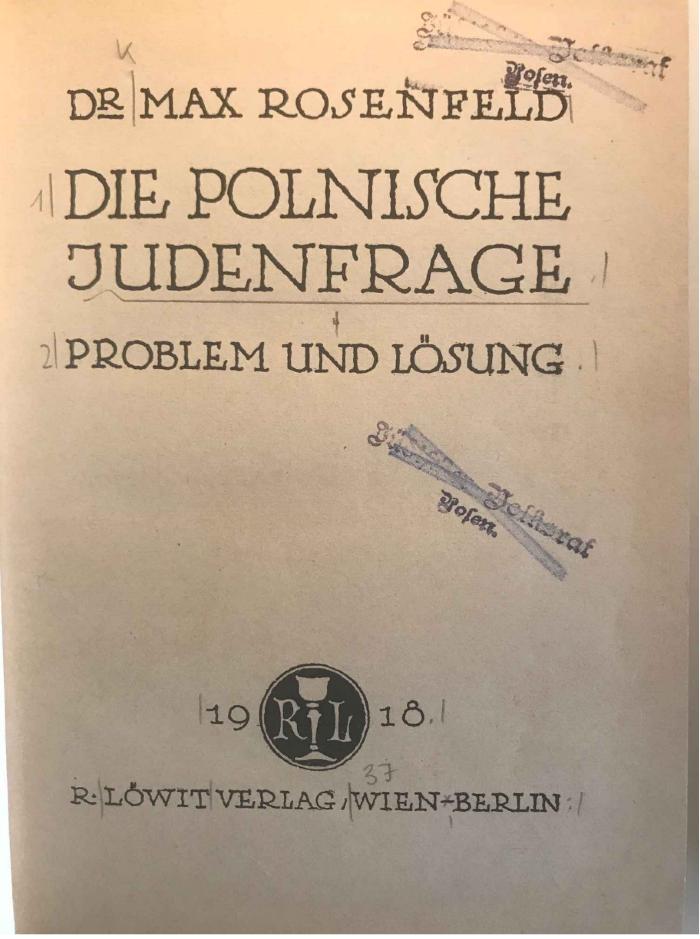Im November 1918 wurde der Jüdische Volksrat Posen auf dem Gebiet der ehemaligen preußischen Provinz Posen (1815–1920) gegründet. Zu den Mitbegründern zählte Rechtsanwalt Dr. Max Kollenscher (1875 in Posen – 1937 in Tel Aviv). Der Volksrat setzte sich aus national-jüdischen und orthodox-jüdischen Gruppierungen zusammen und verfolgte das Ziel, Minderheitenrechte für die jüdische Bevölkerung in der Region einzufordern. Ab Februar 1919 veröffentlichte der Rat das Mitteilungs-Blatt des Jüdischen Volksrates Posen, um seine Anliegen zu kommunizieren.
Nach dem Ersten Weltkrieg führte der polnische Aufstand von 1918 dazu, dass Posen gemäß den Bestimmungen des Versailler Vertrags an die neu gegründete Republik Polen fiel. Die politische Neuordnung und eine Welle antisemitischer Gewalt, darunter zahlreiche Pogrome in verschiedenen Regionen Polens, erschwerten die Arbeit des Volksrates erheblich. Anfang 1920 musste die Organisation ihre Aktivitäten einstellen, da viele Mitglieder zur Auswanderung gezwungen waren.
In den Jahren vor dem Zweiten Weltkrieg flohen viele Juden aus Posen, doch mit der Besetzung der Stadt durch die deutsche Wehrmacht im September 1939 nahm die systematische Verfolgung ihren Lauf. Gauleiter Wilhelm Koppe verfügte im November 1939 die „Säuberung“ der Stadt von Juden, was das Ende der jüdischen Gemeinde in Posen besiegelte. Dies markierte den Beginn der beispiellosen Verfolgung der polnischen Juden auf allen von Deutschland besetzten Gebieten. Unter unmenschlichen Bedingungen mussten viele Juden in Arbeitslagern Zwangsarbeit leisten. Vor dem Krieg lebten in Polen etwa 3,3 Millionen Juden; bis Kriegsende überlebten nur rund 380.000. Nach über 800 Jahren wurden jüdisches Leben und jüdische Kultur in Polen nahezu vollständig ausgelöscht.
Das Archiv in Posen, das beim Kriegsbeginn nur unzureichend evakuiert wurde, geriet nach der Besetzung durch die deutsche Wehrmacht unter deren Kontrolle. Einige polnische Archivmitarbeiter blieben als Hilfskräfte im Dienst, während die meisten ins Generalgouvernement deportiert wurden. Große Mengen an Akten polnischer Behörden, Institutionen und Unternehmen wurden in das Archiv gebracht, wobei viele Dokumente als „wertlos“ eingestuft und vernichtet wurden, um den Besatzungsplänen zu entsprechen.
Ab 1943 begann die gezielte Evakuierung von Archivmaterial. Rund 100 Kisten mit historischen Dokumenten wurden in die Salzgrube Grasleben bei Lüneburg verbracht, weitere 80 Kisten an unbekannte Orte. Zusätzlich lagerten die Besatzer Akten in Kirchen und Landgütern rund um Posen. Während der Kämpfe um die Stadt brannte das Archivgebäude nieder. Dabei gingen etwa 320.000 Dokumente, Bücher und Zeitschriften aus dem 19. und frühen 20. Jahrhundert verloren. Auch die wertvolle Archivbibliothek mit etwa 30.000 Bänden wurde vermutlich vollständig zerstört.